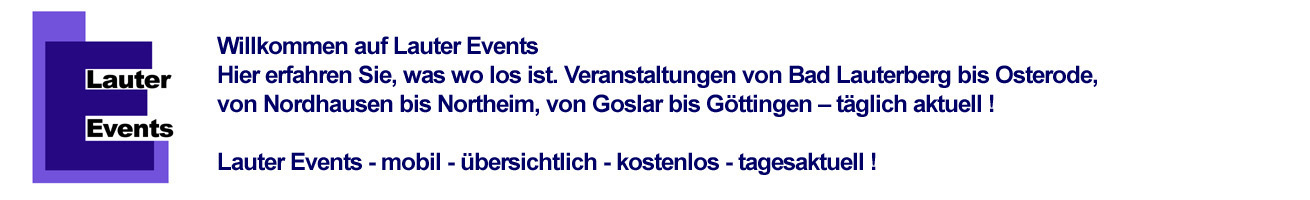Sergej Prokofjew, Ouvertüre über hebräische Themen op. 34
Benjamin Yusupov, „Images of the Soul.“ Konzert für zwei Klarinetten und Orchester
Dmitri Schostakowitsch, Kammersinfonie für Streichorchester nach dem Streichquartett Nr. 8 op. 110a
Ludwig van Beethoven, Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-Moll op. 80
Gedenkansprache: Christian Carius, Präsident des Thüringer Landtags
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 2018 jährt sich zum 80. Mal ein sehr düsteres Kapitel der deutschen Geschichte. In die Veranstaltungen zu diesem denkwürdigen Jahrestag der Reichspogromnacht reiht sich unser musikalischer Beitrag ein.
Sergej Prokofjew komponierte seine Ouvertüre über hebräische Themen 1919 für das jüdische Ensemble Simso, ein Sextett. Die von charakteristischen Klezmerklängen durchdrungene Musik arrangierte er selbst später für Orchester. Für die Zwillingsbrüder Alexander und Daniel Gurfinkel schuf der 1962 in Tadschikistan geborene Komponist Benjamin Yusupov sein Klarinettenkonzert „Images of the Soul“. In der jüdischen Tradition steht die Klarinette für die Seele. „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ schrieb Dmitri Schostakowitsch 1960 im kriegszerstörten Dresden sein 8. Streichquartett.
Ludwig van Beethovens Chorfantasie op. 80 wird auch als „Kleine Neunte“ bezeichnet, denn er nahm in dieser Musik bereits die Liedmelodie „Freude schöner Götterfunken“ aus der 9. Sinfonie vorweg. Somit steht die Chorfantasie stellvertretend für das später entstandene Werk, das auf der ganzen Welt zum Ausdruck von Frieden und einer Völker verbindenden Vision geworden ist.
Musiktheater für Kammermusikensemble und Stimmen
Text von Franz Kafka
Mit Unterstützung des „The Nicholas Berwin Charitable Trust“
„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“ Komisch und grausam zugleich schildert Franz Kafka in seiner berühmten Erzählung die Leiden eines ganz gewöhnlichen jungen Mannes, der sich plötzlich als sprachloser Käfer in seiner Familie wiederfindet. Christoph Ehrenfellner schuf daraus ein Musiktheater für Klaviertrio und Sprecher, das sich besonders an junge Ohren richtet. In der ersten Komposition des Composer in Residence speziell für das Theater Nordhausen kratzt und schabt der Käfer, zischt der Vater und erschreckt sich die Schwester hörbar in der Musik. Eine übergroße Käfer-Puppe tritt neben den Schauspielern auf die Bühne und gibt Kafkas Erzählung eine unmittelbare Wirkung. Zarte Momente der Hingabe wechseln mit Kämpfen und Komik.
Gastspiel im Rahmen der Kooperation mit dem Theater Rudolstadt
Hänsel und Gretel leben in Not und bitterer Armut. Doch da ihre Eltern nach besten Kräften für sie sorgen, sind sie nicht unglücklich. Als es den Eltern jedoch trotz aller Mühen nicht mehr gelingt, die Kinder zu ernähren, beschließen sie, die beiden fortzuschicken. In der Fremde, hinter dem Wald, wird es ihnen besser gehen, dort werden sie Brot essen, keine Birkenrinde. Hänsel und Gretel wollen nicht weg von zu Hause und markieren, um wieder zurückzufinden, den Weg mit Kieselsteinen und ihren letzten Brotkrumen. Anders als bei den Brüdern Grimm sind die zwei Kinder nicht auf sich allein gestellt. Ihnen folgen ihre treuen Freunde, eine gewitzte Taube und ein verwegener Kater. Zu dumm aber, dass die ahnungslosen Tiere die meisten Orientierungszeichen auffressen. Deshalb landen die vier Abenteurer nicht wieder daheim bei den Eltern, sondern im vermeintlichen Schlaraffenland. Die Freude über das ungewöhnliche Haus aus Kuchen, Keksen und Lollis währt kurz, denn die Hausherrin entpuppt sich als böse Hexe mit Riesenappetit. Wie gut, dass Gretel auf die Unterstützung von Taube und Kater zählen kann. So wird nach der Rettung aus höchster Not sogar noch ein großes Wunder geschehen.
Übrigens: Jacob Grimm erlangte mit seinem Bruder Wilhelm Grimm Weltruhm als Märchensammler. Mit seinen Werken legte er einen bedeutenden Grundstein zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache. 1808 wurde der 28-Jährige in Kassel Bibliothekar bei Jérôme Bonaparte, der von seinem Bruder Napoléon I. als König von Westfalen inthronisiert wurde. Nach den Befreiungskriegen 1814 bis 1815 erfüllte Jacob Grimm diplomatische Aufgaben in Paris und Wien und nahm 1815 am Wiener Kongress teil. In Göttingen hat er später als einer der Göttinger Sieben gegen die Aufhebung der Verfassung durch König Ernst August II. von Hannover protestiert. Er wurde 1837 mit einem Berufsverbot belegt und des Landes verwiesen. Jacob Grimm gilt als Begründer der Germanistik.
Gastspiel im Rahmen der Kooperation mit dem Theater Rudolstadt
Hänsel und Gretel leben in Not und bitterer Armut. Doch da ihre Eltern nach besten Kräften für sie sorgen, sind sie nicht unglücklich. Als es den Eltern jedoch trotz aller Mühen nicht mehr gelingt, die Kinder zu ernähren, beschließen sie, die beiden fortzuschicken. In der Fremde, hinter dem Wald, wird es ihnen besser gehen, dort werden sie Brot essen, keine Birkenrinde. Hänsel und Gretel wollen nicht weg von zu Hause und markieren, um wieder zurückzufinden, den Weg mit Kieselsteinen und ihren letzten Brotkrumen. Anders als bei den Brüdern Grimm sind die zwei Kinder nicht auf sich allein gestellt. Ihnen folgen ihre treuen Freunde, eine gewitzte Taube und ein verwegener Kater. Zu dumm aber, dass die ahnungslosen Tiere die meisten Orientierungszeichen auffressen. Deshalb landen die vier Abenteurer nicht wieder daheim bei den Eltern, sondern im vermeintlichen Schlaraffenland. Die Freude über das ungewöhnliche Haus aus Kuchen, Keksen und Lollis währt kurz, denn die Hausherrin entpuppt sich als böse Hexe mit Riesenappetit. Wie gut, dass Gretel auf die Unterstützung von Taube und Kater zählen kann. So wird nach der Rettung aus höchster Not sogar noch ein großes Wunder geschehen.
Übrigens: Jacob Grimm erlangte mit seinem Bruder Wilhelm Grimm Weltruhm als Märchensammler. Mit seinen Werken legte er einen bedeutenden Grundstein zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache. 1808 wurde der 28-Jährige in Kassel Bibliothekar bei Jérôme Bonaparte, der von seinem Bruder Napoléon I. als König von Westfalen inthronisiert wurde. Nach den Befreiungskriegen 1814 bis 1815 erfüllte Jacob Grimm diplomatische Aufgaben in Paris und Wien und nahm 1815 am Wiener Kongress teil. In Göttingen hat er später als einer der Göttinger Sieben gegen die Aufhebung der Verfassung durch König Ernst August II. von Hannover protestiert. Er wurde 1837 mit einem Berufsverbot belegt und des Landes verwiesen. Jacob Grimm gilt als Begründer der Germanistik.
Gastspiel im Rahmen der Kooperation mit dem Theater Rudolstadt
Hänsel und Gretel leben in Not und bitterer Armut. Doch da ihre Eltern nach besten Kräften für sie sorgen, sind sie nicht unglücklich. Als es den Eltern jedoch trotz aller Mühen nicht mehr gelingt, die Kinder zu ernähren, beschließen sie, die beiden fortzuschicken. In der Fremde, hinter dem Wald, wird es ihnen besser gehen, dort werden sie Brot essen, keine Birkenrinde. Hänsel und Gretel wollen nicht weg von zu Hause und markieren, um wieder zurückzufinden, den Weg mit Kieselsteinen und ihren letzten Brotkrumen. Anders als bei den Brüdern Grimm sind die zwei Kinder nicht auf sich allein gestellt. Ihnen folgen ihre treuen Freunde, eine gewitzte Taube und ein verwegener Kater. Zu dumm aber, dass die ahnungslosen Tiere die meisten Orientierungszeichen auffressen. Deshalb landen die vier Abenteurer nicht wieder daheim bei den Eltern, sondern im vermeintlichen Schlaraffenland. Die Freude über das ungewöhnliche Haus aus Kuchen, Keksen und Lollis währt kurz, denn die Hausherrin entpuppt sich als böse Hexe mit Riesenappetit. Wie gut, dass Gretel auf die Unterstützung von Taube und Kater zählen kann. So wird nach der Rettung aus höchster Not sogar noch ein großes Wunder geschehen.
Übrigens: Jacob Grimm erlangte mit seinem Bruder Wilhelm Grimm Weltruhm als Märchensammler. Mit seinen Werken legte er einen bedeutenden Grundstein zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache. 1808 wurde der 28-Jährige in Kassel Bibliothekar bei Jérôme Bonaparte, der von seinem Bruder Napoléon I. als König von Westfalen inthronisiert wurde. Nach den Befreiungskriegen 1814 bis 1815 erfüllte Jacob Grimm diplomatische Aufgaben in Paris und Wien und nahm 1815 am Wiener Kongress teil. In Göttingen hat er später als einer der Göttinger Sieben gegen die Aufhebung der Verfassung durch König Ernst August II. von Hannover protestiert. Er wurde 1837 mit einem Berufsverbot belegt und des Landes verwiesen. Jacob Grimm gilt als Begründer der Germanistik.