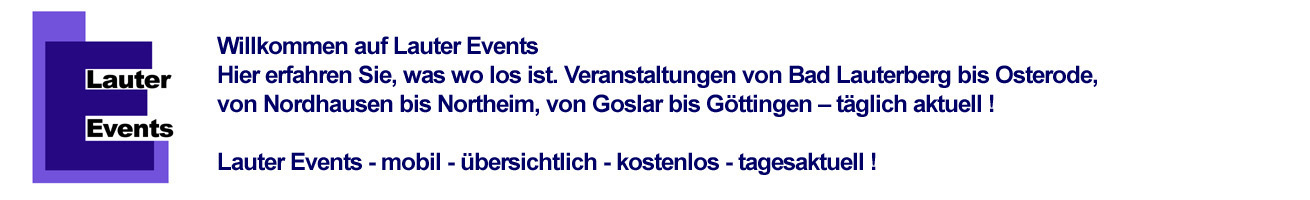Bei Fatoni ist’s alles ein bisschen anders. Vor ein paar Jahren glaubte er selbst nicht mehr an eine Musikkarriere. Dann wurde er Deutschraps schärfster Beobachter, mit schelmischem Humor und zynischem Zeigefinger. Und nun, wo es drauf ankommt, auf dem vorläufigen Hoch seiner Karriere, tritt er mit „Andorra“ die Flucht nach vorn an: Fatoni erzählt zum ersten Mal so richtig von sich selbst.
Dabei sein ist alles. Als Anton Schneider in den Neunzigern die Goldene Ära von Deutschrap miterlebt, will auch er Teil einer Jugendbewegung sein. Seine Helden stehen am Mic, rauchen Pflanzen und erklären ihm die Welt in Freestyles. Anton gründet mit seinen Münchner Freunden eine Rap-Crew – nur ist da gerade nicht mehr so viel Platz für die Philosophien postpubertärer Mittelständler. Also macht Anton in Hochkultur, inklusive Schauspielstudium an der renommierten Otto Falckenberg Schule. Was er damals nicht ahnt: dass er gute zehn Jahre später als Fatoni die Rolle seines Lebens findet.
Im Jahr 2019 ist Fatoni eine der unwahrscheinlicheren Figuren im deutschen Popzirkus – schon deshalb – weil er mit Mitte dreißig gerade seinen zweiten Karrierefrühling durchlebt. Schuld daran ist vor allem „Yo, Picasso“, jenes Album, auf dem sich Fatoni 2015 mit Platinproduzent Dexter duellierte und dabei eine neue Stimme fand. Es war die Platte, an die Fatoni schon selbst nicht mehr glaubte – und man muss sie erwähnen, um „Andorra“ zu verstehen. Weil in „Yo, Picasso“ schon vieles von dem steckte, was Fatoni heute zu einem so brillanten Erzähler macht: sein unglaublich präziser Blick auf das Geschehen und der gewitzte Charme, mit dem Fatoni all das kommentiert, was uns Menschen schlichtweg zum absurdesten Phänomen auf diesem Planeten macht.
Wie Fatoni seine Umwelt sezierte, war schon damals ziemlich Kunst. Das Haar in der Suppe – wenn man es denn unbedingt finden wollte: Was den Menschen hinter der Künstlerpersona antrieb, ließ sich nur erahnen. „Andorra“ braucht genau einen Song, um damit zu brechen: „Alles zieht vorbei“ ist vielleicht der ehrlichste Song, den Fatoni je schrieb. In jedem Fall ist er der Ergreifendste. Und er steht endlich ganz vorne. „Früher habe ich die autobiografischen Songs immer ans Ende der Platte gepackt, weil ich mich nicht so recht traute“, gesteht Fatoni. Mit „Alles zieht vorbei” verhandelt er zum Einstieg mal eben einen Autounfall, legt diverse Angstgeständnisse ab und gesteht sich die größte Künstlerkrux überhaupt ein, das ewige Ringen um Anerkennung. Dann plötzlich, aus dem Nichts – Auftritt Dirk von Lowtzow, Tocotronic-Frontmann und Diskurs-Pop-Don höchstpersönlich: „Nichts ist so einfach, alles so kompliziert/Fremde Lebensentwürfe hast du schon immer romantisiert.“
Apropos fremde Lebensentwürfe: Natürlich geht es auf „Andorra“ auch um „Die Anderen“. Die leben einem den ganzen Quatsch schließlich vor. So wie Kifferkumpel Jan, mit dem sich Fatoni als 17-Jähriger die Bong teilte und der heute, rund 17 Jahre später, beim jährlichen Wiedersehen mit kruden Verschwörungstheorien um sich wirft. Oder „Mitch“, der Junkie, den der kleine Anton einst mit seinem Vater bewusstlos im Park auffand. Oder „D.I.E.T.E.R.“, Deutschlands erfolgreichster Schlagerproduzent, der sein Glück in der Ignoranz findet. Fatoni erzählt von diesen Personen, wie er schon immer von ihnen erzählt hat: in unglaublich humorvollen Anekdoten voll kleinster Details. Nur wo er früher als Mensch Distanz wahrte, sucht er nun Nähe. Wo Sarkasmus herrschte, ist plötzlich Empathie. Weil Fatoni sich nun selbst neben all diese Figuren stellt, wenn sie die Wege seiner Biografie streifen. Auf gesellschaftliches Neben-, Mit- und Gegeneinander bezieht sich auch der Albumtitel: nicht nur auf das gleichnamige Theaterstück von Max Frisch, sondern speziell auf den danach benannten „Andorra-Effekt“. Dieses sozialpsychologische Phänomen beschreibt menschliches Verhalten, das sich an Urteile und Erwartungen der Umwelt anpasst – und da sind sie wieder, die Anderen.
Man kann das auch so sehen: Früher wollte uns Fatoni die Welt erklären. So hat er das gelernt. Erst in seinem bürgerlich-intellektuellen Elternhaus, dann im Neunziger-Rap und schließlich am Theater. Er weiß, wie man sich den Kopf zerbricht. Aber Fatoni fühlt sich eigentlich ziemlich wohl dort, wo er gerade steht. Er lebt heute von dem, was er liebt. Er steht auf den Bühnen der Festivals und Clubs, die ihn prägten. Und er bekommt Liebe von all seinen früheren Helden – wirklich von allen. Selbst die Illustratorenlegende Klaus Voormann, der „fünfte Beatle“, der das „Revolver“-Album bebilderte, für Lou Reed am Bass saß und Trios „Da Da Da“ produzierte, sagte mit Begeisterung zu, als Fatoni fragte, ob er nicht das Cover für „Andorra“ illustrieren wolle. „Mein sechzehnjähriges Ich würde komplett durchdrehen, hätte es gewusst, was noch passiert“, sagt ein Anton „Fatoni“ Schneider, der heute mehr bei sich ist als je zuvor in seiner Karriere. Vielleicht hat er deswegen den Zeigefinger eingezogen.
Dass sich Fatoni wohl fühlt, liegt auch an dem Umfeld, mit dem er heute seine Kreativität teilt. In Dexter fand Fatoni den Partner, der ihm nicht nur Beats auf dem Leib schneidert, sondern mit dem er eine musikalische Vision teilt. Wenn „Yo, Picasso“ noch auf dem klassischen Rollenspiel von Produzent und Rapper fußte, dann ist „Andorra“ das künstlerische Statement, das Fatoni nicht nur als Rapper zeigt, sondern – so viel Pathos muss erlaubt sein – als Musiker.
Fatoni ist heute ein Musiker, der Skizzen befreundeter Produzenten wie Torky Tork, Fid Mella oder Occupanther mit zu Dexter ins Studio bringt, wo die beiden gemeinsam am Detail feilen. Er setzt sich mit seiner Gitarre in die Gesangskabine, um mit „Krieg ich alles nicht hin“ seine vollkommen unpeinliche Hommage an die Ärzte zu performen. Er ist ein Musiker, der mit überheblichen Punchlines und einem Casper-Feature auf „Burj Khalifa“ mal eben den Zeitgeist von Rap bezwingt. Vor allem aber ist er Musiker, weil er gelernt hat, Songs zu schreiben, die in Würde altern. „Wenn man Rap auf der Höhe der Zeit macht, wird man immer in jener Zeit bleiben“, meint Fatoni. Deshalb hat er so viele Spielereien auf seinem letzten Mixtape „Im Modus“ geparkt. Die Songs, die man noch in zehn Jahren hören will, sind nun auf „Andorra“. Weil sie keinen Trend jagen. Vor allem aber, weil sie schlichtweg so unglaublich gut erzählt sind.
Die schönsten Geschichten schreibt das Leben, so sagt man. Die zweitschönsten schreibt Anton „Fatoni“ Schneider. Und zwar dann, wenn er aus seinem Leben erzählt.