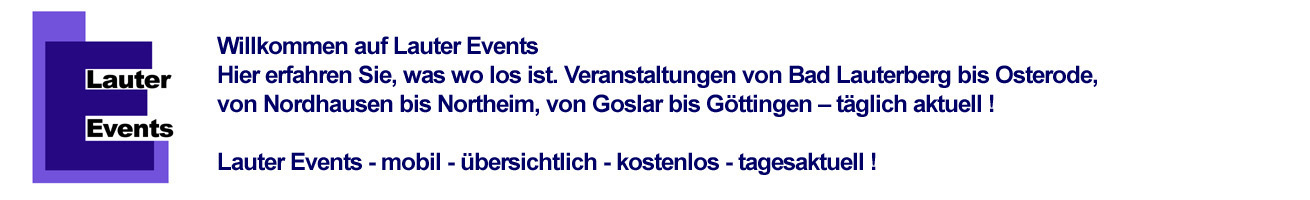Eine Tragikomödie von Josef Hader und Alfred Dorfer
Sie sind mit einem robusten Mandat ausgestattet: Im Auftrag des Fremdenverkehrsverbandes reisen Heinz Bösel und Kurt Fellner durch die Lande und überprüfen die Qualität von Landgasthöfen. Sie essen sich durch rustikale Speisekarten und schlafen in durchgelegenen Betten, immer auf der Suche nach dem Haar in der Suppe oder der tröpfelnden Dusche. Zwei Männer, die gegensätzlicher nicht sein könnten, zwei Grantler vom Dienstherren in inniger Abneigung verbunden. Das Schnitzel ist die Lieblingsspeise, denn über dessen Qualität lässt sich vortrefflich räsonieren und worüber soll man auch reden an all den langen Abenden, die man gezwungenermaßen gemeinsam in ländlichen Gaststuben verbringt. Auch über Frauen lässt sich reden, wenn auch in einer Weise, die Frauen besser nicht zu Ohren kommt. Und auch wenn der Kollege Bösel behauptet, das andere Geschlecht verstanden zu haben, ahnt man ein großes Missverständnis. Doch plötzlich nimmt die letzte Dienstreise eine andere Wendung und die beiden hartgesottenen Helden des Gastrotests erweisen sich hinter den Fassaden ihrer derben Männlichkeit als durchaus empfindungsfähige Zeitgenossen.
Das Deutsche Theater Göttingen wird wieder mobil. Mit »Indien« steht eine Produktion zur Verfügung, die vor allem für die Gaststuben und Wirtssäle der Göttinger Umgebung gedacht ist. Kontakt: Alida Kleine 0551.49 69-14
Josef Hader
Der österreichische Autor, Kabarettist und Schauspieler wurde durch sein Auftreten als Ermittler in den Verfilmungen von Wolfgang Haas‘ »Brenner«-Krimis auch jenseits der Kleinkunst-Bühnen bekannt. Sein rabenschwarzer Humor ist mittlerweile legendär.
Alfred Dorfer
Auch Alfred Dorfer ist ein in Österreich vielfach ausgezeichneter Kabarettist. Ähnlich wie Hader ist er ebenfalls als Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler erfolgreich.