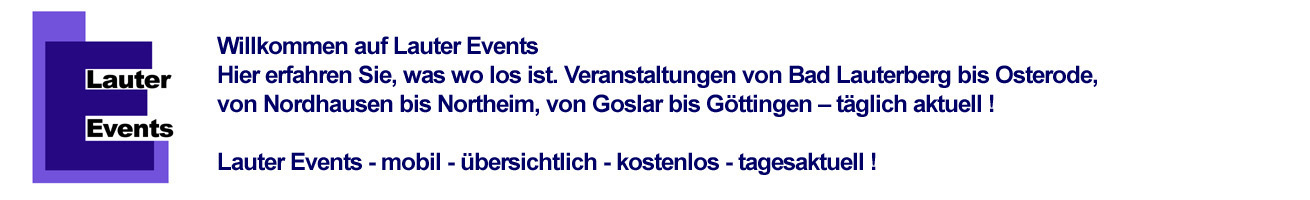Tigermilch
Von Stefanie de Velasco
Ein Schluck Schulmilch, Maracujasaft und Mariacron. Fertig ist die Tigermilch. So nennen Nini und Jameelah das Getränk, das sie sich auf der Schultoilette mixen. Und los geht es in die Stadt. Sie sind 14, finden sich eigentlich erwachsen, weil sie sich an ihre Kindheit erinnern können, und haben möglicherweise ihren letzten gemeinsamen Sommer vor sich, weil es sein könnte, dass Jameelah in den Irak abgeschoben wird. Cool und pomade reisen sie durch den Sommer, spielen Wörterknacken und aus Luft wird Lust, aus Nacht nackt, Lustballons, Nacktschicht, Lustschutzkeller mit Nacktschicht. Sie gehen ins Freibad Pommes essen und treffen Leute aus der Schule, arbeiten am Projekt Entjungferung, feiern Bahnpartys, rauchen Ott in Telefonzellen, hängen mit den anderen aus der Siedlung am Planet ab, versuchen in der Nachbarschaft die Konflikte nicht eskalieren zu lassen. Sie fühlen sich frei und unverwundbar. Sie teilen alles und vertrauen sich. Sie können spielen und gegen die Welt zusammenhalten. Zickereien, Streit, Schwärmereien und Liebeskummer eingeschlossen. Doch gegen den soll ein Liebeszauber helfen und als Nini und Jameelah auf dem Spielplatz mit im Tierpark gesammelten Rosenblättern zaubern, werden sie Zeuge eines Ehrenmordes an einer Siedlungsnachbarin. Und mit einem Mal ist nichts mehr cool und pomade und ihre Freundschaft steht auf dem Spiel.
Poetisch und rau erzählt »Tigermilch« einen Mädchensommer – »Tschick« on Speed.
Stefanie de Velasco
1978 geboren, wuchs Stefanie de Velasco im Rheinland als Kind spanischer Einwanderer auf. Sie studierte Europäische Ethnologie und Politikwissenschaften und war Schriftstellerstipendiatin verschiedener Institutionen. »Tigermilch« ist ihr 2013 erschienener Debütroman, über den Verena Auffermann im Deutschlandradio sagte:
»Der Erzählton ist vereinnahmend und eindringlich. ›Tigermilch‹, die Geschichte aus der Zone zwischen Realität und Fiktion, ist zeitanalytische Erkenntnis. Nah an der realen städtischen Gegenwart und ihren Problemen, ein gelungener literarischer Wurf.«
Besetzung
-

Emre Aksizoğlu
-

Felicitas Madl
-
Nancy Pönitz