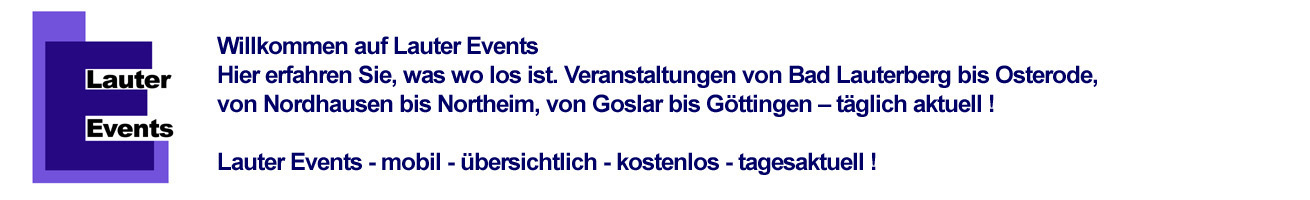Spielzeitabschluß
Von Elfriede Jelinek
Europa ist gerade sehr beschäftigt. Vor allem mit sich selbst. Während die Politik Hilfspakte von historischen Ausmaßen verabschieden, um Europas Wohlstand zu sichern, treibt die Bürger*innen vor allem die brennende Frage um, an welchen Stränden des Mittelmeers man unbeschwert die kostbarste Zeit des Jahres verbringen kann, ohne in Quarantäne zu enden. Distanz ist das Gebot unserer Tage und Europa hält all jene auf Distanz, die in der Hoffnung auf ein sicheres Leben an seinen Grenzen stranden. Und während die einen sorgfältig auf genügend Abstand am Strand und am Hotelbuffet achten, werden in Moria diejenigen mit Stacheldraht auf Abstand gehalten, für die 150 cm Distanz der reine Luxus wäre.
Die Pandemie hat Europa den Lockdown beschert, die Konflikte der Welt aber, zwingen weiterhin unzählige Menschen zur Flucht.
Wir haben deshalb beschlossen, all denjenigen eine Stimme zu verleihen, die an den Grenzen Europas auf Hilfe hoffen, und beenden die Spielzeit mit Elfriede Jelineks Apell an den europäischen Humanismus »Die Schutzbefohlenen«. Bei dieser einmaligen Aufführung wird, wenn auch coronasepariert, das ganze Ensemble des Deutschen Theater Göttingen auftreten.