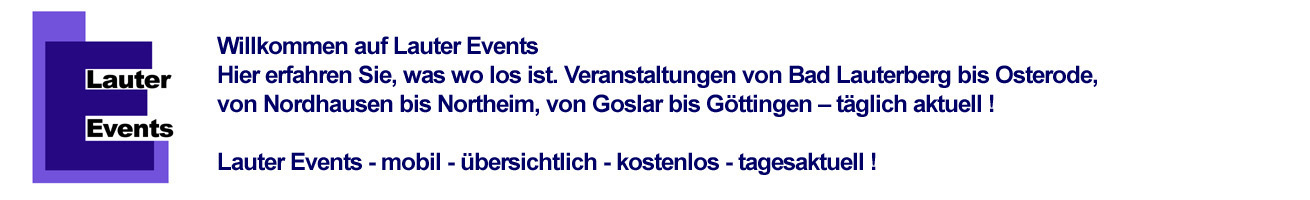Von Johann Wolfgang von Goethe
Iphigenie ist eine Fremde auf Tauris. Sie kann sich der neuen Kultur, in der sie lebt, nicht anpassen und sehnt sich zurück nach Griechenland, wo sie einst von der Göttin Diana vor dem Opfertod gerettet und als Priesterin nach Tauris gebracht wurde. Auf Tauris herrscht König Thoas, den Iphigenie dazu überredete, die uralte barbarische Sitte auszusetzen, nach der jeder Fremde im Tempel der Göttin geopfert werden muss. Als aber Iphigenie den Heiratswunsch des Königs ablehnt, demonstriert er seine Macht, indem er das grausame Opferritual wieder einführt. An dem Fremden, der von den Soldaten des Königs gefangengenommen wurde, will der gekränkte Thoas ein Exempel statuieren. In dem zum Tode verurteilten Mann erkennt Iphigenie ihren Bruder Orest. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um von der Insel in das geliebte Griechenland zu fliehen. Doch Iphigenie bringt es nicht übers Herz, Thoas zu hintergehen. Sie enthüllt ihm den Fluchtplan und legt damit ihr Schicksal und das ihres Bruders in Thoas’ Hände.
Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe, 1749 in Frankfurt am Main geboren, gilt als einer der bedeutendsten Dichter der deutschsprachigen Literatur. Seine Werke zählen bis heute zu den Meisterwerken der Weltliteratur. Er begann sein Jurastudium 1768 in Leipzig, das er aber wegen einer schweren Krankheit unterbrach und 1771 in Straßburg fortsetzte. Auf Einladung von Herzog Carl August zog er nach Weimar, wo er ab 1776 im Staatsdienst arbeitete und das Hoftheater leitete. Seine beiden Italienreisen (1786 bis 1788 und 1790), die er nach persönlichen und künstlerischen Krisen unternahm, empfand er als Wiedergeburt. Goethes Werk umfasst Lyrik,
Dramen, Epik, autobiografische, kunst- und literaturtheoretische sowie naturwissenschaftliche Schriften. Er starb 1832 in Weimar.