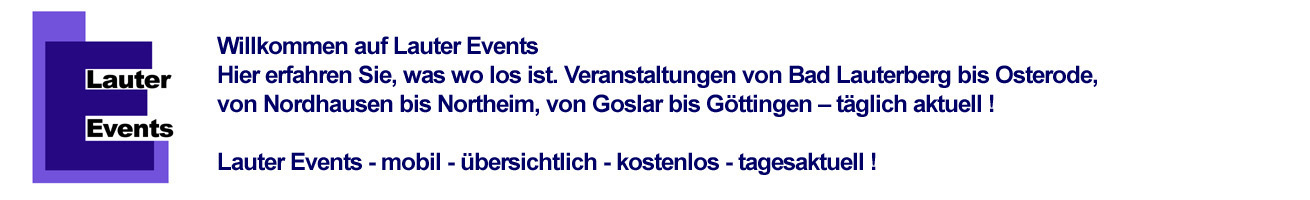Albanipl. 2
37073 Göttingen
Deutschland
Sopran SIMONE KERMES
Tenor SIMON BODE
Bass JOCHEN KUPFER
Chor NORDDEUTSCHER FIGURALCHOR (Ltg. JÖRG STRAUBE)
Bildnerische Gestaltung JOCHEN HEIN
Leitung CHRISTOPH-MATHIAS MUELLER
Joseph Haydns „Londoner Symphonien“ und seine späte Kammermusik sind im heutigen Musikleben allgegenwärtig. Doch warum dann nicht auch seine letzte Oper, das ebenfalls für London bestimmte Werk „L’anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice“? Unter anderem wohl, weil man den Komponisten generell kaum mit seinen Opern in Verbindung bringt. „Haydn auf dem Theater ist nicht mehr Haydn“, urteilte schon sein italienischer Zeitgenosse und Biograph Giuseppe Carpani, und dieses Vorurteil hat sich bis in die Gegenwart gehalten. Dabei galt der Oper jahrelang das Hauptaugenmerk des Esterházyschen Hofkapellmeisters. Ab 1776 brachte er in 1200 Vorstellungen etwa hundert Stücke auf die Bühne, darunter viele eigene. Und als sein Dienstherr 1790 starb, lockte ihn nicht alleine das Angebot des Konzertunternehmers Salomon nach England, sondern auch ein höchst lukrativer Theaterauftrag: Während ihm seine gesamten instrumentalen Beiträge zu den Salomon-Konzerten nur 2000 Gulden einbrachten, wurde die Oper mit 3000 vergütet. Zum Glück im Voraus, denn sie kam wegen eines Kompetenzstreits der beiden Londoner Opernhäuser nicht zu Haydns Lebzeiten, sondern erst 1951 in Florenz zur Aufführung.
Geplant hatte der Impresario Sir John Gallini Großes: Der berühmteste Komponist Europas sollte ihm für das gerade erst wieder eröffnete Haymarket Theatre einen der beliebtesten Opernstoffe neu vertonen: die Geschichte von Orpheus, der durch die Macht des Gesangs seine geliebte Eurydike der Unterwelt entreißt. Für die männliche Titelrolle engagierte Gallini den berühmten Tenor Giacomo Davide, dessen Spezialität die tiefere Tonlage war – Haydn brachte sie geschickt zur Geltung. Eine weitere Attraktion boten die halsbrecherischen Koloraturen eines Kastraten, der die Rolle eines Orpheus begleitenden Genius übernahm. Sie kam im antiken Mythos noch gar nicht vor, doch Gallini dürfte seinen Librettisten Carlo Badini angewiesenhaben, den Originalplot durch mancherlei Erweiterungen bühnenwirksamer und für ein breites Publikum attraktiv zu machen.
Schaurige Höllengeister genügten ihm nicht, es mussten mit Rücksicht auf die Bühnenbildner noch spektakuläre Verfolgungsszenen, Ungeheuer, Menschenopfer, Seesturm und Schiffbruch hinzukommen. Außerdem natürlich ein Eifersuchtsdrama und die seria-typischen Konflikte zwischen Liebe und Pflicht, die Haydn bei der Vertonung der Arien ein möglichst breites emotionales Spektrum ermöglichten.
Ob Haydns Werk allerdings wirklich mit dem leise verebbenden Seesturm enden sollte, bleibt fraglich. Vielleicht hätte er es ja mit einem Triumph der Philosophie oder eines anderen Ideals krönen wollen, stellte jedoch die Arbeit ein, als das Theater die königliche Konzession nicht erhielt. In diesem Fall hatte die verhinderte Aufführung zumindest ein Gutes: Sie bescherte uns anstelle des konventionellen Ausgangs einen originellen und wirkungsvollen.