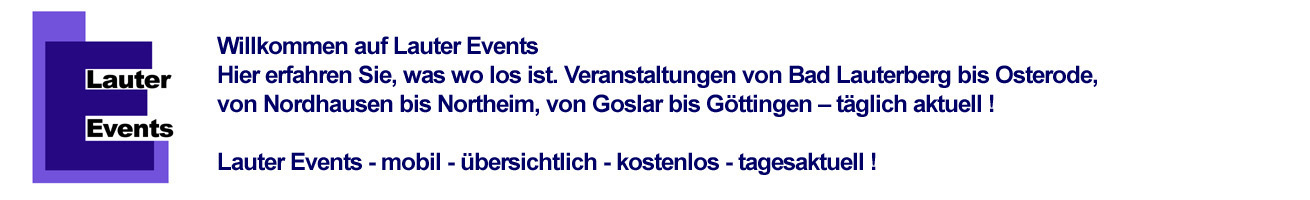»Dass Max Goldts Werk sehr komisch ist, weiß ja nun jeder gute Mensch zwischen Passau und Flensburg. Dass es aber, liest man genau, zum am feinsten Gearbeiteten gehört, was unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder an Eleganz und Poesie enthält und dass sich hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz verbergen, entgeht noch immer vielen, die nur aufs Lachen und auf Pointen aus sind. Max Goldt gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet.« Daniel Kehlmann
© Axel Martens
Eric-Emmanuel Schmitt
Aus dem Französischen von Annette und Paul Bäcker
Auf einer einsamen norwegischen Insel findet ein explosives Treffen zweier sehr ungleicher Männer statt: Abel Znorko, gefeierter Autor und Literaturnobelpreisträger, hat sich hier in die Einöde zurückgezogenm, um dem Medienrummel um seine Person zu entkommen. Dass er ausgerechnet dem Lokaljournalisten Erik Larsen ein Interview gewährt, verwundert zunächst, vor allem, weil er den Gast mit knapp verpassten Schüssen begrüßt. Das Interview mit dem überheblich-arroganten Gastgeber dreht sich um Znorkos neuen Bestseller, ein scheinbar fiktiver Briefroman, der hinreißende Liebesbriefe enthält. Larsens Fragen kommen immer wieder auf die fiktive Liebhaberin aus dem Roman zurück und obwohl Znorko mit seiner herablassenden Art versucht eine intellektuelle Übermacht zu demonstrieren, lässt dieser sich nicht einschüchtern. Das Gespräch entwickelt sich in eine Richtung, die bald offenlegt, dass die zwei Männer ebenbürtiger sind, als es zunächst vermuten lässt und dass sie dunkle Geheimnisse haben, die ihrer beider Vergangenheit verbindet.
Eric-Emmanuel Schmitt
Aus dem Französischen von Annette und Paul Bäcker
Auf einer einsamen norwegischen Insel findet ein explosives Treffen zweier sehr ungleicher Männer statt: Abel Znorko, gefeierter Autor und Literaturnobelpreisträger, hat sich hier in die Einöde zurückgezogenm, um dem Medienrummel um seine Person zu entkommen. Dass er ausgerechnet dem Lokaljournalisten Erik Larsen ein Interview gewährt, verwundert zunächst, vor allem, weil er den Gast mit knapp verpassten Schüssen begrüßt. Das Interview mit dem überheblich-arroganten Gastgeber dreht sich um Znorkos neuen Bestseller, ein scheinbar fiktiver Briefroman, der hinreißende Liebesbriefe enthält. Larsens Fragen kommen immer wieder auf die fiktive Liebhaberin aus dem Roman zurück und obwohl Znorko mit seiner herablassenden Art versucht eine intellektuelle Übermacht zu demonstrieren, lässt dieser sich nicht einschüchtern. Das Gespräch entwickelt sich in eine Richtung, die bald offenlegt, dass die zwei Männer ebenbürtiger sind, als es zunächst vermuten lässt und dass sie dunkle Geheimnisse haben, die ihrer beider Vergangenheit verbindet.