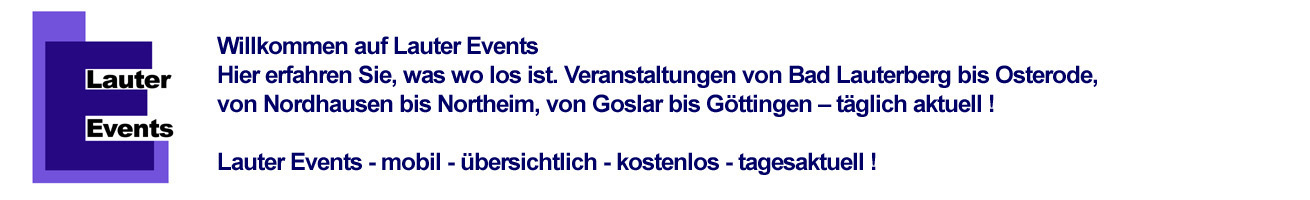Ein Projekt von Prof. Dr. Sascha Münnich und Jan Philipp Stange
Professor Sascha Münnich lehrt Soziologie an der Universität Göttingen. Er hat keine Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch keine Theologie studiert, sondern forscht zu Geld und den Folgen der Finanzkrise. Der junge Goethe wollte ebenfalls Professor in Göttingen werden, jedoch hegte sein Vater einige Abneigungen gegen die Leinestadt. So musste Johann Wolfgang Dichter werden: Nach Golde drängt / am Golde hängt / doch alles. Faust II, der Tragödie Zweiter Teil, verhandelt die Nachwirkungen einer Staatspleite. Der Kaiser hat alles ausgegeben, doch Mephisto schöpft neues Geld aus dem Nichts, gedeckt mit den noch ungehobenen Bodenschätzen des Landes. Damit ist die Spekulation in der Welt und ebenfalls der Zwang zur Profitsteigerung, Konkurrenz, Krise und Ausbeutung. Für diesen Abend tun sich Theater und Wissenschaft wieder zusammen, um dem Geheimnis des Geldes auf die Spur zu kommen, dem großen Mythos, was die Welt / im Innersten zusammenhält.
Sascha Münnich
Professor Dr. Sascha Münnich, geboren 1977, ist seit 2013 Professor für International Vergleichende Soziologie am Institut für Soziologie der Georg-August-Universität Göttingen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den sozialen und kulturellen Bedingungen kapitalistischer Ökonomien und der sie flankierenden Wohlfahrtsstaaten. Zusätzlich ist er der Leadsänger mehrerer Bands, u. a. Men in Black.
Jan Philipp Stange
Jan Philipp Stange, geboren 1987, lebt und arbeitet in Frankfurt am Main als Regisseur, Autor und Performer. Er studierte Literatur, Philosophie, Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Regie in Hamburg und Frankfurt. Seine Inszenierungen wurden u. a. am Schauspielhaus Hamburg, im Thalia Theater Hamburg, bei der Ruhrtriennale, im Mousonturm Frankfurt und im Volkstheater München gezeigt.